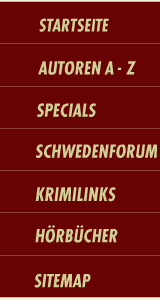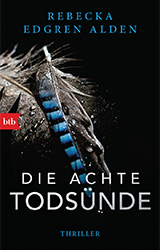"Ich möchte Sie einladen, mit mir eine Reise zu unternehmen."
Vortrag des Bestseller-Autoren Henning Mankell
Übersetzung: Eva Sternberg
Quelle: Zsolnay-Verlag
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie das in Schweden
(und in Afrika) so üblich ist, möchte ich mit einer Geschichte
beginnen.
Wir denken gemeinhin, und zu Recht, daß es vier Möglichkeiten
gibt, mit anderen Menschen oder mit uns selbst Kontakt aufzunehmen oder
aber uns neues Wissen anzueignen: reden, zuhören, schreiben und
lesen. Doch es gibt gewisse Situationen, in denen das nicht stimmt.
In denen weder die gesprochene noch die geschriebene Sprache entscheidend
ist und andere Kommunikationsformen größere Bedeutung haben.
Ich möchte Sie einladen, mit mir eine Reise zu unternehmen. Die
billigsten und schnellsten Reisen macht man in seiner Phantasie. Weder
Paß noch Fahrkarten noch Geld sind hier notwendig. Begeben wir
uns also auf eine Reise, und zwar zuerst nach Norden.
 |
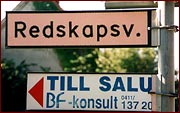 |
Impressionen
aus Skandinavien
(c) Kerstin Seeland |
|
 |
Machen wir halt in einem unbedeutenden nordschwedischen
Dorf namens Sveg. Dort bin ich großgeworden. Damals, in den fünfziger
Jahren, lag Sveg völlig abseits, entfernt von allem.
Wenn versehentlich mal ein Stockholmer Auto dort auftauchte, dann war
das geradezu eine Sensation. Dort, am nördlichen Ufer des Flusses
Ljusnan, bin ich also aufgewachsen. Und ich weiß heute noch ganz
genau, daß ich im Alter von sechs bis sieben Jahren in diesem
Fluß Krokodile gesehen habe. Für andere waren es sicher Baumstämme
auf ihrer langen Fahrt zum Meer. Aber für mich blieben es Krokodile.
Das verriet ich jedoch wohlweislich niemandem. Es war eben mein Geheimnis.
Der Fluß Ljusnan war also der Kongo, der durch meine Kindheit
floß. Wie alle Kinder las auch ich die Erzählungen der großen
Forschungsreisenden Mungo Park, Stanley, Livingstone, Burton, Darwin.
Ich glaube, ich habe sehr früh im Leben erkannt, was für ein
außerordentlich sinnlicher Genuß das Reisen, das Aufbrechen
ist. Ich empfinde es heute noch als einen fast erotischen Genuß,
meine Koffer zu packen und loszuziehen. Im Grunde hat meine Reise nach
Afrika mit den Krokodilen begonnen.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch etwas anderes
erwähnen: Ich glaube, Kinder sind die eigentlichen Künstler.
In der Kindheit haben Phantasie und Wirklichkeit denselben Stellenwert.
Dieses Gleichgewicht beginnt dann, sich zu verschieben, zunächst
wenn wir in die Schule kommen, und dann immer mehr im Laufe des Lebens.
Wenn man sich also irgendwie künstlerisch betätigen will,
heißt das, sich sein Leben lang zu bemühen, etwas von jenem
Gleichgewicht aus Phantasie und Wirklichkeit zurückzuerobern, das
man als Kind besessen hat. Es hat schließlich doch zwanzig Jahre
gedauert, bis ich das erste Mal nach Afrika kam.
Man kann tatsächlich nach Hause kommen an einen Ort, an dem
man noch nie war.
Ich erinnere mich noch heute an jenen Morgen Anfang der siebziger Jahre,
an dem ich in aller Herrgottsfrühe in einem westafrikanischen Land
aus dem Flugzeug stieg. Sofort überfielen mich diese Düfte,
die Afrika ausmachen. Verlockende, beängstigende, bittere, süße,
verführerische, magische, träumerische Düfte. Ich fühlte
mich sofort zu Hause, was eigentlich völlig unerklärlich ist,
denn in meiner Familie gibt es weder Missionare noch andere Geistliche.
Aber ich glaube, in diesem Augenblick wurde mir etwas klar, das ich
bis dahin nicht begriffen hatte und das zu den größten Geheimnissen
des Lebens gehört. Man kann tatsächlich nach Hause kommen
an einen Ort, an dem man noch nie war. Das war für mich das Ende
dieser kindlichen Sehnsucht nach der Ferne, nach dem Aufbruch, nach
dem »Land am Ende der Welt«.
Seitdem hat sich natürlich meine Beziehung zu Afrika verändert
und vertieft und ist zu einem entscheidenen Teil meiner Identität
als Schriftsteller geworden. Nun stehe ich sozusagen ziemlich breitbeinig
da, mit dem einen Fuß im Schnee und dem anderen im Sand. Wenn
man versuchen will, Einfluß zu nehmen auf die heutige Zeit, dann
ist, so glaube ich wenigstens, eine gewisse doppelte Optik notwendig.
Es ist, als hätte ich jetzt einen Beobachtungsturm in Europa und
einen in Afrika. Dadurch erfasse ich die Welt deutlicher. Natürlich
bilde ich mir keineswegs ein, ich sei auf dem Weg, mich in einen Afrikaner
zu verwandeln. Aber Afrika macht mich zu einem besseren Europäer,
und das ist etwas ganz anderes.
Doch unsere Reise geht weiter. Machen wir unsere nächste Pause
auf einem kleinen Friedhof in Südschweden. Wer sich dort umschaut,
findet in einer Ecke des Friedhofs ein einfaches Kreuz über einem
Grab. Auf einem kleinen Messingschild ist folgende erstaunliche Inschrift
zu lesen: »Hier ruht Josef, geboren in der Kalahariwüste 1868,
gestorben in Lunnarp, Schweden 1880.« Man stutzt. Was ist das eigentlich
für eine Geschichte, die hier begraben liegt? Wer war wohl dieser
Josef? Wie kommt es, daß ein kleiner Buschmannjunge auf einem
ländlichen Friedhof in Schweden begraben wurde? Ich habe einige
Nachforschungen angestellt und die Konturen einer sowohl tragischen
als auch traurigen Geschichte zutage gefördert. Aber irgendwie
paßt sie in die heutige Zeit. Ich will sie kurz erzählen.
Nun stehe ich sozusagen ziemlich breitbeinig da, mit dem einen Fuß
im Schnee und dem anderen im Sand.
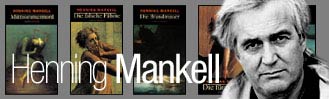 Um
1855 herum begab sich ein schwedischer Entomologe in den Teil des südlichen
Afrika, der heute Botswana und Namibia umfaßt. Ich glaube, er
war weder gut noch böse. Er hatte keine kolonialen Bestrebungen.
Er fuhr einfach los, um bislang unbekannte Insekten zu erforschen und
vielleicht einige neue zu entdecken. Auf seinen Fahrten traf er einen
schwedischen Großwildjäger namens Andersson, der sich in
der gleichen Gegend aufhielt. In der Handelsstation jenes Andersson
fand der Entomologe einen kleinen, verlausten, mageren Jungen, der in
einer Art Pappschachtel hauste. Andersson erklärte, er habe den
Jungen gegen ein Gewehr getauscht. Der Junge war Waise, und niemand
kümmerte sich um ihn. Der Entomologe hatte ein gutes Herz und beschloß,
ihn zu adoptieren und ihn nach Schweden mitzunehmen. In den Tagebuchaufzeichnungen,
die ich gefunden habe, erzählt er rührend, wie er während
der langen Seefahrt von Kapstadt aus Seemannsanzüge für Josef
nähte. 1875 kamen sie in Schweden an. Um
1855 herum begab sich ein schwedischer Entomologe in den Teil des südlichen
Afrika, der heute Botswana und Namibia umfaßt. Ich glaube, er
war weder gut noch böse. Er hatte keine kolonialen Bestrebungen.
Er fuhr einfach los, um bislang unbekannte Insekten zu erforschen und
vielleicht einige neue zu entdecken. Auf seinen Fahrten traf er einen
schwedischen Großwildjäger namens Andersson, der sich in
der gleichen Gegend aufhielt. In der Handelsstation jenes Andersson
fand der Entomologe einen kleinen, verlausten, mageren Jungen, der in
einer Art Pappschachtel hauste. Andersson erklärte, er habe den
Jungen gegen ein Gewehr getauscht. Der Junge war Waise, und niemand
kümmerte sich um ihn. Der Entomologe hatte ein gutes Herz und beschloß,
ihn zu adoptieren und ihn nach Schweden mitzunehmen. In den Tagebuchaufzeichnungen,
die ich gefunden habe, erzählt er rührend, wie er während
der langen Seefahrt von Kapstadt aus Seemannsanzüge für Josef
nähte. 1875 kamen sie in Schweden an.
Aus alten Zeitungsausschnitten jener Zeit habe ich von Vorträgen
erfahren, die der Entomologe hier und da in Schweden gehalten hat. Nur
wenig war hier von ihm die Rede, dafür um so mehr von dem kleinen
»Hottentottenknaben«, der mit ihm durch die Lande zog. Einige Jahre
später fuhr der Entomologe wieder nach Afrika zurück. Doch
Josef sollte in Schweden bleiben. Er kam bei einem Kätner in Lunnarp,
einem Ort in der südöstlichen Ecke Schwedens, unter. Dort
sollte er in die Schule gehen, bei einem protestantischen Pfarrer Unterricht
nehmen und in Holzpantoffeln laufen lernen. Einige Jahre später
starb Josef im Alter von nur zwölf Jahren. Auf dem Totenschein
ist als Todesursache Tuberkulose angegeben. Es gibt keinen Grund, das
anzuzweifeln.
Aber ich bin davon überzeugt, daß er auch an etwas ganz anderem
gestorben ist, an etwas, das sich nicht in Worte fassen oder auf einem
Totenschein angeben läßt. Es war wohl die Traurigkeit; er
hat sich zu Tode getrauert. Ich kann ihn vor mir sehen, mutterseelenallein
auf den lehmigen Äckern in Schonen, im Nebel. Wie er dasteht und
horcht nach den Trommeln in der Ferne. Seine Ohren hören nichts
als das Rascheln der Blätter in den Baumkronen und das Gekrächze
der Krähen. Wahrscheinlich hat er sich gefragt, wo der warme Sand
geblieben ist. Weshalb man so bleischwere Schuhe tragen muß, daß
einem die Lust am Laufen vergeht. Wo die Geister seiner Vorfahren geblieben
sind. Und seine Eltern. Und sein ganzes Leben. Für mich liegt hier
der tiefere Sinn von Josefs Geschichte.
Es ist, als stünde er auf der anderen Seite des Lebensflusses,
winkte uns zu und erinnerte uns daran, daß der gute Wille allein
nicht ausreicht, um einem anderen Menschen zu helfen oder ihn zu stützen.
Guter Wille muß von Vernunft begleitet sein. Sonst führt
er eher zu negativen als zu positiven Ergebnissen. Diese Geschichte
erzähle ich oft angehenden Entwicklungshelfern. Und meine Schlußfolgerung
ist immer dieselbe: Vernünftig handeln heißt, die Leute zu
fragen, denen man beistehen möchte. Vielleicht sollte man sogar
gerade denen zuhören, auf die man laut gewisser Ratgeber überhaupt
nicht hören sollte. Genau das ist der Sinn von Josefs Geschichte.
Über ihn werde ich übrigens irgendwann ein Buch schreiben.
Guter Wille muß von Vernunft begleitet sein.
Sonst führt er eher zu negativen als zu positiven Ergebnissen.
Zwischen Josef und der Frage der Bosheit besteht kein augenfälliger
Zusammenhang. Ich möchte trotzdem einige Worte dazu sagen. In Schweden
ist im Moment ein Thema aktuell, das mich erschreckt und wütend
macht. Es geht um die Bosheit. In den Schlagzeilen ist oft von »sinnloser
Gewalt« die Rede. Dabei stellt sich sofort die Frage: Wie sieht denn
wohl sinnvolle Gewalt aus? Daß wir in einer Welt und in einer
Zeit leben, in der immer öfter Gewalt ausgeübt wird, ist offensichtlich.
Es gibt Jugendliche, die einander grundlos foltern und ermorden. Doch
ab und zu werden Stimmen laut, die im Ernst behaupten, Bosheit sei bei
manchen Menschen angeboren.Es gebe sie von Geburt an, und sie liege
in den Genen. Das hieße, Bosheit hätte den gleichen Ursprung
wie Sommersprossen. Oder Kahlköpfigkeit. Und das macht mir angst.
Gewinnt diese Auffassung die Oberhand, dann werden sicher über
kurz oder lang Forderungen laut, Waffen sollten im nächsten Lebensmittelladen
zu kaufen sein. Dann gehen wir wahrlich dunklen Zeiten entgegen. Der
Krieg aller gegen alle. Männer, die sich im Schutze der Dunkelheit
aufmachen, um Jagd auf böse Menschen zu machen. Das heißt
auch, daß der rationale Humanismus, das rationale Menschenbild,
demzufolge es keine in genetischer Hinsicht bösen Menschen gibt,
auf verlorenem Posten ist. Bosheit ist nicht mit Sommersprossen oder
Kahlköpfigkeit zu vergleichen. Es ist eine Frage der äußeren
Umstände, die dazu führen, daß Menschen böse Taten
begehen. Und diese Umstände müssen wir bearbeiten und bekämpfen.
Das hieße, Bosheit hätte den gleichen Ursprung wie Sommersprossen.
Oder Kahlköpfigkeit. Und das macht mir angst.
Ich spreche und schreibe oft über dieses Thema. Darüber, daß
wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Menschen an den Rand der
Gesellschaft gedrängt werden und eine Randgruppenexistenz führen
müssen. Es gibt junge Menschen, die nicht damit rechnen können,
jemals in ihrem Leben Arbeit zu finden.
Menschen, die sich in ihrem eigenen Land überflüssig und unwillkommen
fühlen. Das sind die Umstände. Und Menschen, die sich ausgestoßen
fühlen, reagieren eben. Vielleicht sogar mit Gewalt. Die Wurzeln
der Bosheit liegen in den äußeren Umständen. Nicht in
unseren Genen. Daß das Menschenbild die Bürger in mehrere
Lager spaltet, geschieht nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Doch
nach wie vor ist es von größter Bedeutung, gegen die Leute
einzutreten, die Mythen und Wahnvorstellungen verbreiten wollen, zum
Beispiel die, daß der Teufel gelegentlich bei der Zeugung eines
Kindes mitmischt. Das gibt mir das Stichwort zu einer Reihe von Büchern,
die ich in den neunziger Jahren geschrieben habe. In diesen Büchern
spielt ein ganz unauffälliger schwedischer Kriminalkommissar die
Hauptrolle. Er heißt Kurt Wallander und wohnt in der kleinen südschwedischen
Stadt Ystad. Als ich zum ersten Mal über ihn und seine Kollegen
schrieb, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, daß sich
so viele Menschen für ihn interessieren würden. Ich hätte
mir nie träumen lassen, daß diese Bücher in einer Gesamtauflage
von über drei Millionen Exemplaren erscheinen und in fünfzehn
verschiedene Sprachen übersetzt würden, darunter Deutsch und
Französisch. Am Anfang hatte ich nur vor, ein Buch zu schreiben.
1989 kehrte ich für ein Jahr nach Schweden zurück. Schnell
wurde mir klar, daß Fremdenfeindlichkeit dort zu einer entscheidenden
gesellschaftlichen Frage geworden war. Etwa so, als läge eine Bombe
vor den Füßen jedes einzelnen Schweden, und er verschlösse
dennoch die Augen.
| Buchtipp |
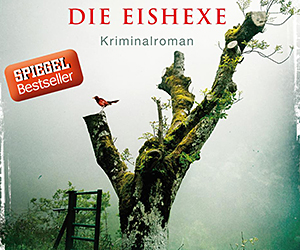 |
Daraufhin habe ich mich entschlossen, ein Buch über Rassismus zu
schreiben. Da Rassismus für mich kriminell ist, schien es mir ganz
natürlich, eine Kriminalintrige zu verwenden. So weit, so gut.
Jetzt fehlte mir natürlich noch ein Polizist. So entstand Kurt
Wallander. Es liegt mir sehr daran, zu betonen, daß Wallander
aus meinem Bedürfnis heraus geboren wurde, über Rassismus
zu schreiben. Einen anderen Grund gab es nicht. Nachdem das erste Buch
von der Leserschaft so positiv aufgenommen worden war, begriff ich,
daß ich mir mit diesem Kriminalkommissar ein Werkzeug geschaffen
hatte. Ich entschloß mich, weitere Geschichten über ihn zu
schreiben. Ausgangspunkt sollte sein, die Entwicklung der schwedischen
und vielleicht auch der europäischen Gesellschaft unter die Lupe
zu nehmen. Ihr Zustand sollte sich in verschiedenen Verbrechen widerspiegeln.
Ich wollte versuchen, die in den Tiefen des schwedischen Rechtsstaates
schwelenden Krankheiten offenzulegen. Ich wollte zeigen, wie es im morschen
Unterbau des Rechtsstaates nur so knarzt. Mir lag daran, eine ganz einfache
Wahrheit festzustellen.
Es liegt mir sehr daran, zu betonen, daß Wallander aus meinem
Bedürfnis heraus geboren wurde, über Rassismus zu schreiben.
Wenn der Rechtsstaat nicht funktioniert, dann ist die gesamte Demokratie
bedroht. Denn ohne glaubwürdigen Rechtsstaat kann Demokratie einfach
nicht funktionieren. Insgesamt gibt es acht Wallanderromane. Ich möchte
nicht Gefahr laufen, der Fließbandarbeit bezichtigt zu werden
und das Schreiben zur Routine werden zu lassen. Das würde einer
nicht-literarischen Tätigkeit gleichkommen. Damit würde ich
weder den Lesern noch mir einen Gefallen tun. Und heutzutage, wo fast
alles angeblich »in Bewegung« ist, scheint es mir wichtig, die große
Kunst des Innehaltens nicht zu vergessen. Ich habe natürlich oft
darüber nachgedacht, warum Kurt Wallander so beliebt ist. Ich wage
zu behaupten, daß es am Inhalt der Bücher liegt. Sie behandeln
etwas, das viele Menschen angeht. Aber ich glaube, es hat auch damit
zu tun, daß Wallander selbst sich in ständigem Wandel befindet.
Wie Sie und ich. Die literarische Glaubwürdigkeit liegt darin,
daß man die Widersprüchlichkeit eines Menschen wiedergibt.
Mir persönlich sind Bücher zuwider, wo ich nach ein paar Seiten
alles über eine Gestalt weiß, und die dann keine Veränderungen
mehr durchläuft. Kurt Wallander dagegen ist im siebten Buch ganz
anders als im ersten. Das macht ihn glaubwürdig, denn insofern
ähnelt er uns.
Ich habe natürlich oft darüber nachgedacht, warum Kurt
Wallander so beliebt ist.
Die letzte Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen möchte,
kommt aus Mosambik, aus dem nördlichen Teil des Landes. Wie Sie
alle wissen, gab es dort dreißig Jahre lang fast ununterbrochen
Krieg. Mit dem Befreiungskrieg gegen die Portugiesen 1964 fing es an.
Dann folgte ein Bürgerkrieg. 1992 kam endlich der Frieden. Gegen
Ende der achtziger Jahre befand sich das Land in einer äußerst
prekären Lage. Millionen von Menschen waren auf der Flucht, eine
Million war gestorben, es gab Hunger und Elend. Ich bin damals in den
Norden des Landes gereist.
Eines Tages war ich zu Fuß auf dem Weg zu einem Dorf. Mir entgegen
kam ein Mann, mager, vielleicht auch hungrig. Seine Kleider hingen in
Fetzen. Dann sah ich seine Füße. Was ich erblickte, werde
ich mein Lebtag nicht vergessen: Ich habe es beim Schreiben stets vor
Augen. Er hatte Schuhe auf seine Füße gemalt. Mit Erdfarben.
Das war die letzte Möglichkeit für ihn, seine Würde zu
bewahren. Dieser Wunsch war stärker gewesen als das Elend, das
ihn seiner Würde zu berauben drohte. Ich glaube, in meinen Büchern
geht es um diesen Mann. Um Menschen, die sich nie unterkriegen lassen,
egal wie schlecht es gerade aussieht.
Und beim Schreiben habe ich immer folgenden Leitgedanken: Eines Tages
können wir alle in eine Situation geraten, in der wir darauf gefaßt
sein müssen, Schuhe auf unsere Füße zu malen. Und dann
müssen wir sicher sein, daß wir dazu auch fähig sind.
In meinen Büchern geht es um Menschen, die sich nie unterkriegen
lassen, egal wie schlecht es gerade aussieht.
Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das lautet: »Der
Mensch hat zwei Ohren, aber nur eine Zunge.« Damit wir mehr zuhören
und weniger reden. Und deshalb höre ich jetzt auf.
Henning Mankell, Schriftsteller |