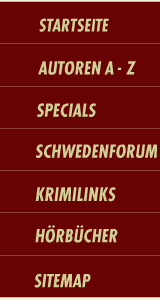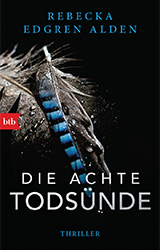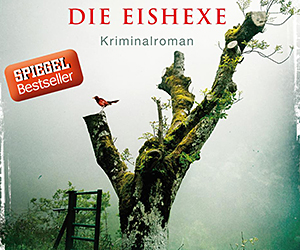Einer kennt des anderen Kreuz nicht
"Allen guten Menschen, denen diese Blätter vor Augen kommen mögen, schicke ich, Eiulvur Kolbeinsson, der unwürdige Kaplan an der Saurbärkirche des Rödesand-Kirchspiels, im Bardestrand-Bezirk, Gottes Gruß und den meinigen."
So beginnt das Buch „Schwarze Schwingen“ (im dänischen Original: „Svartfugl“), welches im Jahr 1929 in Dänemark erschienen ist und dann als deutsche Ausgabe 1930 bei Albert Langen in München. Eiulvur Kolbeinsson, der Nachfolger des alten Gemeindepfarrers, hatte gerade seinen einzigen Sohn im Alter von fünfzehn Jahren beim Fischfang verloren und wird durch diesen Schicksalsschlag an eine andere Geschichte erinnert. Er beginnt, diese niederzuschreiben. Und dieser Kaplan, Eiulvur Kolbeinsson, ist die eigentliche Hauptfigur dieses Romans.
„Meine Unzulänglichkeit, die Gott gesehen hat, war weit verhängnisvoller. Sie trat da zutage, wo es sich nicht um Fische und Friestuch handelte, sondern um Blut. Nicht um Silber und Gold, sondern um Seelen. Du hast sie gesehen, o Herr, diese Unzulänglichkeit, aber bis heute nur du allein!
Forderst du mich nun vor Gericht, da du mein einziges Kind, meinen Sohn Hilarius, als eine jammervolle Beute blinden Mächten hinwirfst?
So stehe ich jetzt vor dir. Stärke du meine Hand, dass es ihr gelingen möge, einen Funken Wahrheit aus dem dunklen Stein zu schlagen, den ich in meiner Brust trage!“
Am Anfang des 19. Jahrhunderts teilten sich zwei sehr arme Familien den kleinen, sehr abgeschiedenen Bauernhof Syvendeaa bei Rauðisandur (der Landstrich bezieht seinen Namen vom weitläufigen Strand aus gelblich-rotem Muschelsand) in den Westfjorden. Die Sache war die, daß Bjarni nach dem Tode seiner beiden Jungen, die Hälfte seines Hofes an Jon Torgrimsson verpachtet hatte, der mit seiner Frau und ihren fünf Kindern dahingezogen war. Aber allmählich wurde im Kirchspiel über die Zwietracht gesprochen, die draußen auf jenem einsamen Hofe zwischen den beiden Bauern herrschte, ja selbst zwischen den beiden Ehepartnern untereinander. Eines Wintertages wurde der Bauer Jon vermisst. Die wahrscheinlichste Erklärung war, daß er auf dem vereisten Weg an den Klippen entlang abstürzte und ins Meer gefallen ist, als er Heu für seine Schafe aus einer Hütte holen wollte. Niemand hatte gesehen, wie es zugegangen war. Niemand hatte ihn seither wiedergesehen. Die Menschen in der Kirchengemeinde begannen zu glauben, daß Bjarni, der damit anfing, die Witwe des verschwundenen Bauern Jon Torgrimsson, als seine Geliebte zu betrachten, Jon umgebracht hatte. Bjarni war ein gutaussehender Mann, aber seine Frau Gudrun war eine unscheinbare Frau und nicht bei guter Gesundheit. Bjarnason verliebte sich in Steinunn Sveinsdóttir, die Witwe. Dann starb Gudrun, die Frau von Bjarni. Und in der Gemeinde entstand das Gerücht, daß sie ebenfalls umgebracht worden war. Vergiftet oder zu Tode geschlagen worden ist durch Bjarni und die Witwe Steinunn. Aber dies geschah alles, bevor gerichtsmedizinische Untersuchungen in Island auf das Land kamen und so wurde die Frau begraben und das Leben ging weiter. Dann wurde die Leiche von Jon Torgrimsson gefunden. Sie lag wie Treibholz am Strand. Der Leichnam wurde anhand der Kleidung identifiziert und bei der gesetzlichen Leichenschau entdeckte man eine Verletzung, die von einer Stichwaffe herrühren konnte und die kaum auf einen Sturz von den Klippen in das Meer zurückgeführt werden konnte. Sehr bald wurden Bjarni und Steinunn daraufhin festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Während dieser Zeit starben die drei Kinder von Bjarni und Gudrun in der Obhut des Kaplans, als sie vom Pfarrhaus ausrissen. Sie ertranken oder erfroren. Trotzdem konnte der Kaplan das Vertrauen von Steinunn und Bjarni erringen und sie gestanden ihm, daß sie zusammen die zwei anderen umgebracht hatten und dann versuchten, die Morde als Unglücke zu vertuschen. Beide wurden zum Tode verurteilt. Steinunn starb kurz darauf im Gefängnis, Bjarni konnte noch einmal fliehen, wurde aber wieder gefasst und 1804 wurde er in Dänemark hingerichtet, da sich auf Island niemand fand, der das Urteil vollstrecken wollte oder konnte.
| Buchtipp |
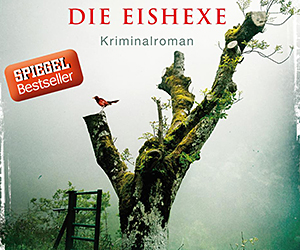 |
Gunnar Gunnarsson bezieht sich in seinem Roman auf einen authentischen Kriminalfall. Einem Mordfall, der sich auf dem Hof Sjöundá am Rauðisandur in den Westfjorden zugetragen hatte. Und dies tut er so genau, dass man eigentlich von einem historischen Dokumentarroman sprechen könnte. Ein literarischer Kriminalroman, wie er heutzutage von Andrea Maria Schenkel geschrieben wird. Ganz verhaftet in der Epoche, in welcher der Roman spielt, in der Sprache und dem Duktus der damaligen Zeit. Erfunden ist zum größten Teil der Rahmen der Erzählung, der Erzähler, der Kaplan und seine Familie. Was den eigentlichen Fall betrifft, hat Gunnarsson von Originaldokumenten (Verhöre, Urteile, Gerichtsprotokolle) ausgiebig Gebrauch gemacht. Der Doppelmord aber fand so statt wie im Roman beschrieben. Sicherlich ist es ein Kriminalroman in dem Sinne, das ihm ein Verbrechen zu Grunde liegt. Doch wenn der Roman als Kriminalroman klassifiziert wird, muß er in Übereinstimmung mit der Literaturgattung Kriminalroman sein, muß er genauso kraftvoll und literarisch sein, wie die anderen Arten der Literatur. Das Buch ist ein Beweis dafür, daß alle literarischen Genres in dem Sinne mehr oder weniger gleich sind, daß ein großer Schriftsteller ein literarisches Meisterstück in jeder Gattung schreiben kann, das er sich zu eigen macht.
Mit „Schwarze Schwingen“ setzte Gunnarsson die Reihe seiner historischen Romane fort, hielt sich jedoch wesentlich enger an die Quellen, mit denen er sich eingehend beschäftigt hatte. Der Autor folgte zwar getreu den historischen Vorlagen, doch ist das Buch kein Tatsachenbericht, sondern eine dichterische Gestaltung des vorgegebenen Stoffes. Der Stil erinnert in seiner kräftigen, zügigen Diktion zeitweilig an den der altisländischen Saga; weist aber auch für den Verfasser typisch-mystisch anmutende Merkmale auf. Überzeugend sind die so verschiedenartigen Personen gezeichnet. Die Selbstzweifel des Kaplans, der hin- und hergerissen ist in der Schuldfrage. Der ständig fragt, was ist böse - was ist gut? Wer trägt hier die Schuld. Hätte das Verbrechen verhindert werden können, wenn sich die Gemeinde, in diesem Fall der alte Pfarrer als Amtsperson, sich mit den Gerüchten beschäftigt hätte, die im Kirchspiel herumginge? Und in wie weit trägt der Kaplan Schuld an diesem Geschehen. Er, der Bjarni bewunderte und die offiziellen Leichenschauen vornehmen mußte.? "
Ich fing an zu glauben, ich bringe den Leuten Unglück, und in meinem Gefolge seien Verbrechen und grausiger Tod."
Der Roman besticht durch den detailfreudigen Realismus von Gunnar Gunnarsson. Wie schon in anderen Werken hat Gunnarsson auch hier die herbe, in ihrer Erhabenheit fesselnde isländische Landschaft in breitangelegte Bildern eingefangen und ihre Wechselbeziehung zum Menschen aufgezeigt.
Das Buch schließt mit den Selbstzweifeln des Kaplans:
"...Diese unnützen Blätter,- sie sind nun meine Beichte. ...- werde ich ihnen zu zeigen wagen, was ich hier geschrieben habe? Und wenn ich es tue, - werden sie mir dann sagen können, welchen Anteil ich in all dem Bösen gehabt habe, was damals geschah? Wieviel und welchen?
Dank an Halldór Gudmundsson ("Halldór Laxness - eine Biographie" bei btb) und
Þráinn Bertelsson ("Walküren" bei dtv), die mich mit Informationen über Gunnar Gunnarsson und den authentischen Mordfall versorgt haben.
Vielen Dank an Jürgen Ruckh aus Esslingen
© Juni 2008 Literaturportal schwedenkrimi.de - Krimikultur Skandinavien