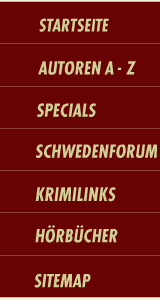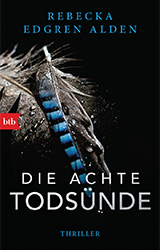|
 |
 |
 |
 |
| Liza
Marklund - Foto: Alexandra Hagenguth/schwedenkrimi.de |
|
 |
Gleichstellung, Politik an der Kühltruhe, Terrorismus und die
Pressefreiheit - Liza Marklund im Gespräch mit dem Literaturportal
schwedenkrimi.de
Anlässlich ihrer Buchpräsentation im Rahmen
der Veranstaltungsreihe "Mord am Hellweg" sprach die Erfolgsautorin
mit Literaturportal schwedenkrimi.de über "Der rote Wolf"
und darüber, was es heißt, prominent zu sein.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
In Ihrem neuesten Roman "Der rote Wolf" geht es um Terrorismus.
Die Idee dazu bekamen Sie jedoch nicht erst nach dem 11. September 2001,
sondern bereits 1996. Was war damals der Auslöser?
Liza Marklund:
Ich war damals Chefredakteurin für eine Tageszeitung, die durch
unsere Kulturministerin eingestellt wurde. Anlass dafür war ein
neues Gesetz, wie ich es in "Der rote Wolf" auch beschreibe.
Sie tat das, weil sie von anderen, unter anderem von der Eigentümerfamilie
eines anderen Medienunternehmens, unter Druck gesetzt wurde. Ich fand
es schrecklich, dass mächtige Leute in der Lage waren, Politiker
derart zu erpressen. Ich dachte, was für eine Macht muss derjenige
über Politiker haben, die unbedingt etwas aus ihrer Vergangenheit
verbergen wollen. Ich begriff auch, dass alles Gerede der Eigentümerfamilie
über Demokratie und Meinungsfreiheit nur leeres Gerede war. Es
ging ausschließlich um den eigenen Machterhalt. Dieses Szenario,
das ich dann ein wenig veränderte, nutzte ich also als Hintergrund
für meinen Roman. Schließlich erfand ich neben den vier tatsächlichen
Traumata Schwedens noch ein fünftes, nämlich dass eine militärische
Flugzeugbasis 1969 in die Luft gesprengt wurde. Ich ließ dieses
Attentat unaufgeklärt und machte es zum Auslöser für
Annikas Recherchen. Gleichzeitig wollte ich der Frage nachgehen, wie
weit Politiker, Medienunternehmen und Menschen überhaupt bereit
sind zu gehen, um ihre Macht zu erhalten. Meine Recherche über
die 60er/70er-Jahre ergab schließlich, dass zu dieser Zeit die
maoistische Bewegung in Schweden recht stark war. Also ließ ich
meine Figuren einen maoistischen Hintergrund haben.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Für die Kulturministerin Karina Björnlund aus "Der rote
Wolf" hat, das erwähnten Sie gerade selbst, eine echte Ministerin
Pate gestanden, Marita Ulvskog. Wie hat sie das denn aufgenommen?
Liza Marklund:
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Wie viel von Marita Ulvskog hat denn die Figur der Karina Björnlund?
Liza Marklund:
Also, beide sind aus Luleå und beide haben einen Hintergrund als
Maoist. Ich versuche, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen,
denn ich finde, manchmal kommt man der Wahrheit mit der Fiktion viel
näher als mit Fakten. Schreibt man Artikel, muss man alles mit
Fakten beweisen können. Ist man als Schriftsteller tätig,
hat man die Möglichkeit, ein wenig dazu zu erfinden und dennoch
ganz nah an der Wahrheit zu bleiben. Manchmal holen einen die Wahrheit
und die Realität auch ein.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es denn Ihrer Ansicht
nach zwischen dem Terrorismus der 60er und 70er Jahre und dem heutigen,
meist islamistisch-fundamentalistischen, Terrorismus?
Liza Marklund:
Es gibt große Unterschiede, aber auch einige gemeinsame Eigenschaften.
Ich glaube, das Wichtigste für Menschen ist, von einer Gruppe akzeptiert
zu werden. Sie wollen um jeden Preis irgendwohin gehören. Sie suchen
ein geistiges Zuhause. Sie brauchen Bestätigung, sie brauchen jemanden,
der sie sieht. Ich glaube, das war kennzeichnend für diese Leute
in den 60ern. Sie suchten das Gefühl der Solidarität, die
Gruppenzugehörigkeit und das Gefühl, etwas zu tun, etwas zu
verändern und dabei zu sein. Die Gruppe dient dann als Spiegel
ihrer selbst. Ähnliches gilt auch für Osama bin Laden und
andere Terroristen dieser Art. Auch sie wollen gesehen werden und zu
jemandem gehören. Aber gefährlich wird es dann, wenn diese
Leute keinen Platz in der Gesellschaft finden und sich ihre Gemeinschaft,
ihre Gruppenzugehörigkeit außerhalb der Gesellschaft suchen.
Genauso wie auch die Fußball-Hooligans. Diese Leute nutzen ein
Fußballspiel, um sich anschließend zu prügeln, aus
Ermangelung an anderen Aktivitäten und weil sie sonst von der Gesellschaft
nicht gesehen, nicht wahrgenommen werden. Das ist krank! Osama bin Laden
und seine Gefolgsleute sind nicht nur sehr kranke Menschen, sondern
hier hat die Gemeinschaft die Züge einer sehr kranken und gefährlichen
Sekte angenommen!
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Was hat denn dann dazu geführt, dass der schwedische Terrorismus
der 60er Jahre nicht dem deutschen, spanischen oder italienischem gefolgt
ist und terroristische Vereinigungen wie die RAF, ETA oder die Roten
Brigaden hervorgebracht hat?
Liza Marklund:
Darüber habe ich viel nachgedacht, denn in Norwegen beispielsweise
ist es ganz anders verlaufen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir die
schwedischen "Terroristen" in unsere Gemeinschaft integriert
haben. Sie sitzen heute in der Regierung. Andere besitzen heute Unternehmen
und haben ganz andere Ansichten als damals… Wieder andere sind
Journalisten oder Schriftsteller geworden. Sie waren damals das Sahnehäubchen
der 68-er Bewegung in Schweden und haben heute in aller Regel sehr mächtige
Positionen.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Macht beinhaltet die Gefahr von Machtmissbrauch, wie es auch in "Der
rote Wolf" von Ihnen thematisiert wird. Hier gibt es sehr viele,
die ihre Macht missbrauchen, nicht zuletzt Annika. Zum Schluss gibt
es einen regelrechten Showdown zwischen ihr und Chefredakteur Schyman.
Am Ende scheint keiner von beiden als Sieger daraus hervorzugehen. Im
Gegenteil, beide sind erpressbar. Wie wird das ihre Beziehung in der
Zukunft beeinflussen?
Liza Marklund:
Ja, darüber kann man nachdenken …
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Müssen wir uns bis zum nächsten Buch gedulden?
Liza Marklund:
Japp! Mich hat interessiert zu sehen, was Annika als
Journalistin tut, wenn sie die Gelegenheit zum Machtmissbrauch erhält.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Annika war sich auch voll bewusst, was sie tat, als sie ihre Macht missbrauchte,
um eine Rivalin los zu werden. Wie ist es denn jetzt um Annikas Integrität
im Nachhinein bestellt? Ist niemand gegen Machtmissbrauch immun?
Liza Marklund:
Exakt! Ich denke, wenn man stark genug bedrängt wird, missbraucht
jeder seine Macht. Das wollte ich zeigen.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Für Annikas Recherche spielt das so genannten "Öffentlichkeitsprinzip",
wie es so nur in Schweden existiert, eine wichtige Rolle. Aber dieses
"Öffentlichkeitsprinzip" hat auch Nachteile, wie Sie
sie selbst in "Mia" und "Asyl", der Fortsetzung
zu "Mia", beschreiben. Warum ist es Ihrer Ansicht nach dennoch
wichtig und richtig, dass es dieses "Öffentlichkeitsprinzip"
gibt?
Liza Marklund:
Das Öffentlichkeitsprinzip funktioniert ausgezeichnet - jedenfalls,
wenn es nicht missbraucht wird. Und nur, weil einige dieses Prinzip
missbrauchen, kann man es nicht abschaffen. Man muss stattdessen diejenigen
beseitigen, die es missbrauchen und die Möglichkeit zum Missbrauch
abschaffen. Wir haben in Schweden eigentlich exzellente Möglichkeiten,
verfolgte und misshandelte Frauen zu schützen. Was im Fall Mia
nicht funktioniert hat, war, dass so viele von Behördenseite aus
geplappert haben. Wenn die Krankenkasse und der Sozialdienst einfach
den Mund halten und keine Daten, die der Geheimhaltung unterliegen,
ausplappern würden, würde es ausgezeichnet funktionieren.
Dort gibt es viel zu häufig Personal, das einsame Beschlüsse
nach eigenem Gutdünken fasst. Da, beim Personal, liegt das Problem,
nicht beim Öffentlichkeitsprinzip.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Wie sähe denn die Gesellschaft aus, die am meisten Ihren Vor- und
Einstellungen entspricht?
| Buchtipp |
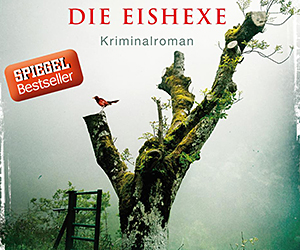 |
Liza Marklund:
Für den Anfang würde es genügen, wenn Männer und
Frauen wirklich gleichgestellt wären. Da sähe die Gesellschaft
schon ganz anders aus. Ich habe eine Freundin, die Forscherin ist und
sich mit der Frage weiblicher Macht in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
beschäftigt. Ich habe sie gefragt, wie die Gesellschaft aussehen
würde, wenn wir die tatsächliche Gleichstellung von Mann und
Frau erreicht hätten. Forscher antworten nicht gerne auf solche
Fragen, doch schließlich antwortete sie, dass vor allem die Anzahl
der Scheidungen sinken würde, da es vor allem die Frauen sind,
die sich scheiden lassen wollen, da sie ihrer Männer überdrüssig
sind. Es würde weiter beinhalten, dass die Lebenserwartung der
Männer steigen würde, denn häufig lassen sie sich nach
einer Scheidung gehen; der Alkoholmissbrauch würde aufgrund geringerer
Scheidungen ebenfalls sinken, die Ausgaben der Krankenkassen würde
sinken, weil die Leute länger gesund blieben, Gewalt und Misshandlungen
gegen Frauen würden abnehmen, weil das häufig die Gründe
für eine Scheidung sind oder die Gewalt nach einer Scheidung ausgeübt
wird; auch die Umwelt würde profitieren, denn häufiger als
Männer sind es Frauen, die - auch unbezahlt - aktiv im Umweltschutz
arbeiten. Eigentlich würde es allen besser gehen: die Lebensqualität
und die Lebenserwartung von Männern und Frauen würde steigen
und auch den Kindern würde es ohne Scheidung besser gehen, sodass
letztlich viel mehr Geld übrig bliebe für Steuersenkungen
oder um es für wichtige Projekte zu nutzen. Dass es nicht zu einer
vollständigen Gleichstellung von Mann und Frau kommt, dafür
sorgen wiederum ein paar wenige, aber sehr mächtige Männer,
die ihre Macht keinesfalls aus der Hand geben wollen.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Wie nahe kommt denn Schweden diesem idealen Bild?
Liza Marklund:
Davon ist auch Schweden noch ganz schön weit entfernt. Die Regierung
hat 1998 eine Untersuchung anstellen lassen und herausgefunden, dass
es bis zur vollständigen Gleichberechtigung von Mann und Frau noch
157 Jahre braucht - jetzt sind wir also nur noch 151 Jahre davon entfernt
…
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Noch mal zum aktuellen Roman zurück: Thomas, Annikas Mann, arbeitet
im Buch in einer Projektgruppe mit, die Gewalt und Drohungen gegen Politiker
untersucht. Auch dieses Thema wurde mit dem Mord an Anna Lindh sehr
aktuell. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr für die
Demokratie von dieser Seite?
Liza Marklund:
Ich glaube, Demokratie muss jeden Tag aufs Neue erobert werden. Das
ist ein Klischee, aber ich glaube daran. Wir können uns nicht zurücklehnen
und sagen, jetzt haben wir die Demokratie, jetzt können wir nach
Hause gehen. Demokratie muss ständig diskutiert werden. Gerade
auch nach dem Mord an Anna Lindh diskutiert man in Schweden sehr intensiv,
ob Politiker jederzeit für das Volk zugänglich sein müssen,
ob sie z.B. an der Kühltheke im Supermarkt mit den Leuten über
den Irak-Krieg diskutieren müssen. Ich persönlich finde, wenn
die Ministerin an der Kühltheke mit einer Packung Milch in der
Hand steht, ist das nicht der richtige Ort, die Irak-Frage zu diskutieren,
denn vermutlich ist sie gerade auf dem Weg nach Hause zu ihren Kindern,
um ihnen Pfannkuchen zu backen. Wenn man den Raum der Politiker immer
weiter einengt, dann besteht die Gefahr, dass die Leute ganz einfach
nicht mehr die Kraft für diesen Job aufbringen. Dann werden aber
nur noch diejenigen Politiker, die die Kraft haben, dem Druck standzuhalten
und die am stärksten und am härtesten, aber nicht mehr notwendigerweise
auch die besten sind. Ich denke auch an Anna Lindh, mit der ich befreundet
war. Ich glaube nicht, dass sie hätte Leibwächter haben wollen.
Sie hat diesen Platz, diesen ‚Freiraum', gebraucht.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Sie sind selbst eine öffentliche Person mit sehr dezidierten Ansichten.
Sind Sie als Journalistin oder Schriftstellerin jemals bedroht worden?
Liza Marklund:
Ja, die ganze Zeit.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Aber das ist doch furchtbar?
Liza Marklund:
Man gewöhnt sich mit der Zeit daran.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Wie nahe darf man also Prominenten kommen? Der europäische Gerichtshof
in Straßburg hat ja im Juni dieses Jahres im so genannten Caroline-Urteil
festgelegt, dass Fotos rein privater Natur, die nicht zu einer Debatte
von allgemeinem, öffentlichen Interesse beitragen, nicht veröffentlicht
werden dürfen. In Deutschland hat das in den Medien großes
Entsetzen hervorgerufen, weil eine der Kernfunktionen des Journalismus',
die so genannte Wächterfunktion, auf dem Spiel stehe. Die Glaubwürdigkeit
von Prominenten könne so nicht mehr überprüft werden.
Was sagen Sie als Journalistin und prominente Schriftstellerin dazu?
Wie nahe darf man Ihnen kommen?
Liza Marklund:
Wir haben in Schweden sehr wenige Paparazzi. In dieser Hinsicht kann
man die deutsche und die schwedische Presse nicht miteinander vergleichen.
Hinzu kommt, dass ich nicht zur "Celebrity Staff" gehöre:
Ich gehe nie zu Premieren - außer meine Tochter spielt im Film
mit, wie zuletzt geschehen -, ich lasse mich von dieser Promi-Welt nicht
vereinnahmen. In dieser Hinsicht bin ich keine öffentliche Person.
Alle meine Personenangaben sind in Schweden auch geschützt, und
über meine Familie und mein Privatleben spreche ich nie in Interviews.
Ich lasse auch nie Journalisten zu mir nach Hause. Meine Familie ist
nicht öffentlich. Öffentlich spreche ich nur über meine
Ansichten und meinen Beruf, aber private Informationen über mich
gibt es nur, insofern sie für die Arbeit wichtig sind. Das akzeptiert
auch die Presse in Schweden. Ich habe ja selbst lang genug im Medienbetrieb
gearbeitet und weiß damit umzugehen. Spontan finde ich allerdings,
dass das Urteil sehr merkwürdig ist und ich finde es auch sehr
unbehaglich, dass ein Gericht dem Fotografen vorschreibt, wo er Fotos
zu machen hat. Man soll Fotos machen können, wo man will - wenn
man sich in der Öffentlichkeit bewegt.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Auch wenn diese Fotos ganz privat Caroline beim Reiten zeigen?
Liza Marklund:
Aber es zwingt sie doch keiner Prinzessin von Monaco zu sein! Soll sie
doch aufhören und in einer Bäckerei Brötchen verkaufen!
Da hat sie bestimmt keine Fotografen vor der Ladentheke stehen. Königlich
zu sein, ist eine freiwillige Entscheidung. Wenn es anstrengend ist,
königlich zu sein, soll sie doch einfach damit aufhören.
Literaturportal schwedenkrimi.de:
Frau Marklund, vielen Dank für das Gespräch!
Autorin:
Alexandra Hagenguth/
© Oktober 2004 - Literaturportal schwedenkrimi.de - Krimikultur
Skandinavien |