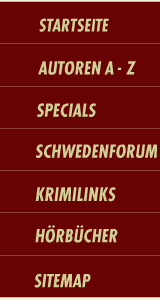Leseprobe
Leseprobe
Für M.
Heute bin ich zum Dieb geworden. Ich habe schon früher etwas gestohlen, doch heute wurde ich zum Dieb. Diejenigen, die sich für so etwas interessieren, sprechen von Herbst-Tagundnachtgleiche. Ein guter Zeitpunkt, um zum Dieb zu werden, denn für kurze Zeit ist alles im Gleichgewicht, ehe die dunklen Kräfte allmählich die Oberhand gewinnen. Ich hatte es nicht geplant. Ich plane nur das Notwendigste. Alles andere mag sich entwickeln, wie es will. Ich ging an einem Laden vorbei und erblickte ein Diktiergerät. Ich blieb stehen und ging hinein. Der Junge hinter der Theke war träge und desinteressiert. Ich bat ihn etwas herauszusuchen, das ich nicht brauchte, und steckte mir rasch das Diktiergerät in die Tasche. Erst draußen auf der Straße wusste ich, wozu ich es benutzen würde. Wenn du dies hörst, dann weißt du es auch. Denn eines Tages wirst du meinen Worten aufmerksam lauschen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstellen werde, aber in Gedanken sehe ich dich schon vor mir liegen, unfähig, dich zu bewegen. Du kannst die Briefe wegwerfen oder verbrennen. Du kannst mich vergessen und dir einreden, dass ich tot bin, obwohl du genau weißt, dass ich irgendwo da draußen lebe. Doch wenn du meine Stimme hörst, wirst du dich an alles erinnern, was du zu mir gesagt hast, und an alles, was ich zu dir gesagt habe. Einst hast du mir von den Zwillingen erzählt. Du hast so viel gelesen und warst so gebildet und wolltest alles mit mir teilen, wo ich doch so gut wie nie ein Buch anrühre. Hieß er nicht Castor, der eine von ihnen? Wir saßen im Klassenzimmer, bevor die anderen hereinkamen, und du erzähltest von ihnen. Castor und Pollux hießen die beiden. Sie waren nicht voneinander zu unterscheiden. Und als der eine in den Himmel kam, wollte der andere lieber in die Hölle, weil sein Bruder dort war. Um mit ihm zusammen zu sein. Bestimmt weißt du nicht mehr, dass du mir davon erzählt hast, aber ich habe es nicht vergessen. Es ist ein sehr gutes Diktiergerät. Man kann Gesagtes löschen, ändern oder mit Hilfe von ein paar Knöpfen einzelne Wörter einfügen. Aber all das brauche ich nicht. Du sollst meine Worte unverfälscht hören, ohne nachträgliche Änderungen. Es ist dieser eine Gedanke, der mich gleichzeitig beruhigt und erregt: Dass du endlich verstehst, was du getan hast.
| Buchtipp |
 |
1
Montag, 24. September
Die Frau saß reglos mit dem Rücken zum Fenster. Ihre Arme hingen schlaff herunter. Ihr aschfahles Gesicht schien erstarrt zu sein. Sie trug eine Bluse und eine grüne Hose. Eine Jacke in derselben Farbe hing ihr lose über den Schultern. Sie hatte hohe, markante Wangenknochen, ihre Augen waren immer noch blaugrün, doch an der Iris zeichnete sich ein milchweißer Rand ab. Unmittelbar hinter ihrem Kopf bog sich ein nackter Birkenzweig im Wind. Plötzlich glitt die Zunge über ihre Zähne, ehe sie den Mund öffnete und den Besucher durchdringend ansah. »Ich warte schon den ganzen Tag«, sagte sie. »Höchste Zeit, dass sich hier endlich mal ein Polizist blicken lässt.« Sie stand auf, trippelte auf ihren hohen Sandalen durch das Zimmer und vergewisserte sich, dass die Tür fest geschlossen war. Dann trippelte sie zurück und setzte sich in den anderen Sessel, der neben dem Schreibtisch stand.
In seltenen Augenblicken waren ihre Bewegungen wieder so energisch wie früher. Die hastige Bewegung, mit der sie sich eine Locke ihrer Dauerwelle aus der Stirn strich, war ihm sehr vertraut.
»Der Grund, warum ich Sie hierhergebeten habe …« Sie hielt inne, um erneut aufzustehen, die Tür zu öffnen und einen Blick auf den Flur zu werfen.
»Hier kann man niemand trauen«, erklärte sie und warf die Tür mit einer Entschlossenheit zu, die ihren Worten vermutlich Nachdruck verleihen sollte. Als sie wieder in dem braunen Ledersessel saß, glättete sie die Hose über ihren Knien.
»Ich warte schon den ganzen Tag«, wiederholte sie, jetzt mit Verzweiflung in der Stimme. »Ich will eine Vermisstenanzeige aufgeben. Sie müssen dringend etwas unternehmen! « Der Besucher war ein Mann in den Vierzigern. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug und darunter ein schlichtes, graublaues Hemd. Die oberen Knöpfe waren geöffnet, ohne dass er deshalb weniger elegant gewirkt hätte.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, entgegnete er, indem er einen Blick auf die Uhr warf.
»Es geht um meinen Mann«, fuhr die Frau fort. »Er ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen.« »Aha«, sagte der Besucher und setzte sich ihr gegenüber auf die Bettkante. »Normalerweise ruft er mich immer an, wenn es später wird, doch bisher habe ich nichts von ihm gehört. Ich befürchte das Schlimmste.«
Sie befeuchtete die trockene Oberlippe und lächelte tapfer. »Und wissen Sie, was das Schlimmste ist?« Der Besucher strich sich mit einer Hand durch die halblangen, frisch geschnittenen Haare. Er wusste, was jetzt kam.
»Das Schlimmste ist …«, stöhnte die Frau und riss angstvoll die Augen auf. »Hast du heute genug zu trinken bekommen?«, warf der Besucher ein. Diese Frage schien ihm wirklich am Herzen zu liegen. »Ich glaube, du bist durstig.« Sie tat so, als habe sie seine Worte nicht gehört. »Die Gestapo«, flüsterte sie mit feuchten Augen. »Ich glaube, ich werde meinen Mann niemals wiedersehen.« Der Besucher blieb fast eine Dreiviertelstunde bei seiner Mutter. Auf ihrem Nachttisch stand ein Getränkekarton mit Orangensaft. Er schenkte ihr zwei Gläser ein, die sie in einem Zug leerte. Nachdem sie ihre große Besorgnis zum Ausdruck gebracht hatte, war das Thema für dieses Mal beendet, und sie blätterte noch ein wenig in einer Zeitschrift. Es war dieselbe Zeitschrift, die schon seit Wochen auf ihrem Tisch lag. Kein einziges Wort sagte sie mehr, als wäre sie wie gebannt von dem einen Bild, das sie unentwegt anstarrte. Nur hin und wieder, wenn sie ihm einen verstohlenen Blick zuwarf, schien ein Lächeln um ihre Mundwinkel zu spielen. Es schien, als ob sie erneut in den undurchdringlichen Dämmerzustand versinken würde, der zunehmend von ihr Besitz ergriff und alles andere abtötete. Er selbst hatte glücklicherweise daran gedacht, sich auf dem Weg eine Zeitung zu kaufen, in der er jetzt blätterte. Als es an der Tür klopfte und ein Pfleger – ein Mann mit graumelierten Haaren, womöglich ein Tamile – die Medikamente brachte, stand er rasch auf und umarmte seine Mutter.
»Ich komme bald wieder«, versprach er. »Judas!«, zischte sie mit kohlschwarzen, schmalen Augen.
Er ließ sich seine Verblüffung nicht anmerken und musste ein Lachen unterdrücken. Sie hob ihr halbvolles Glas, und für einen Moment sah es so aus, als wollte sie ihrem Sohn den Saft ins Gesicht schütten.
»Aber Astrid!«, sagte der Pfleger mit deutlichem Akzent und nahm ihr das Glas ab. Sie stand auf und drohte ihm mit der Faust. »Brede ist ein schlechter Kerl!«, rief sie. »Es war nicht die Gestapo, sondern Brede, der geschossen hat.«
Der Pfleger brachte sie dazu, sich wieder hinzusetzen, doch sie fuchtelte immer noch mit den Armen. »Zwillinge sind einer zu viel! Aber davon versteht ein Neger ja nichts.« Der Besucher warf dem Pfleger einen bedauernden Blick zu. Der Pfleger öffnete die Medikamentendose. »Ich komme nicht aus Afrika, Astrid«, entgegnete er mit breitem Grinsen und reichte ihr das Glas Saft. Sie schluckte eine der Tabletten. »Aber du bist doch Brede«, sagte sie und blinzelte ihren Besucher verwirrt an.
»Nein, Mutter, ich bin nicht Brede. Ich bin Axel.« Er klopfte an die Bürotür der Stationskrankenschwester und trat ein. Als sie ihn erkannte, drehte sie sich auf ihrem Schreibtischstuhl herum und wies mit der Hand auf das Sofa. »Setzen Sie sich doch bitte für einen Moment.« Sie war in den Dreißigern, hochgewachsen und athletisch gebaut, mit einem Gesicht, das ihm gefiel.
»Meine Mutter wirkt zurzeit äußerst unruhig.« Die Stationskrankenschwester nickte kurz. »Sie hat in letzter Zeit viel vom Krieg gesprochen. Alle hier wissen ja, wer Torstein Glenne war, aber ist da eigentlich irgendwas dran mit der Gestapo?«
Axel zeigte auf die Packung mit Maryland Cookies, die auf dem Tisch stand. »Entschuldigung, aber dürfte ich mir vielleicht einen Keks nehmen? Ich hatte heute keine Zeit, etwas zu Mittag zu essen.« Kaffee und Saft lehnte er dankend ab und amüsierte sich im Stillen über den Eifer, mit dem die Krankenschwester ihn plötzlich zu umsorgen versuchte. »Dass die Gestapo damals hinter meinem Vater her war, ist richtig«, bestätigte er kauend. »Erst im letzten Moment ist ihm die Flucht nach Schweden gelungen. Wovon meine Mutter allerdings nichts wusste. Sie ist ihm erst vierzehn Jahre später begegnet. Sie war damals vier.« Die Stationsschwester hatte ein wenig Mühe, ihre glatten Haare zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden. »Solche Informationen sind sehr wertvoll für uns. Sie wird immer sehr unruhig, wenn im Fernsehen irgendein Kriegsbericht kommt. In letzter Zeit mussten wir jedes Mal ausschalten, wenn die Nachrichten anfingen. Wer ist denn eigentlich dieser Brede?«
Axel Glenne bürstete sich ein paar Krümel vom Revers. »Brede?« »Ja. Ihre Mutter hat in letzter Zeit viel von diesem Brede gesprochen. Dass er nicht hierherkommen soll und sie ihn niemals wiedersehen will und solche Sachen. Manchmal redet sie sich so in Rage, dass wir ihr ein Sobril zusätzlich geben müssen. Da niemand weiß, ob dieser Brede wirklich existiert, wissen die Pfleger gar nicht, was sie dazu sagen sollen.« »Brede war ihr Sohn.«
Die Augenbrauen der Stationsschwester schossen nach oben.
»Sie haben einen Bruder? Das wusste ich nicht. In all den Jahren sind ja immer nur Sie hier gewesen. Manchmal auch Ihre Frau mit den Kindern.« »Es ist über fünfundzwanzig Jahre her, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hat«, sagte Axel. Er stand auf und legte die Hand auf die Klinke, zum Zeichen, dass ihr Gespräch beendet war.
Danke an den Droemer Verlag für die Veröffentlichungserlaubnis. |