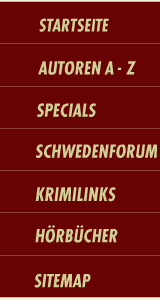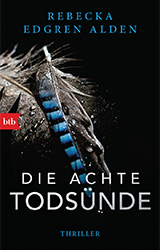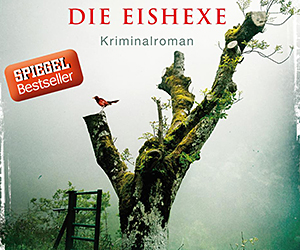Manchmal muß ein Buch gegen seinen Verlag verteidigt werden. In Fall von Torkil Damhaugs "Die Netzhaut" richten sich die kritischen Einwände gegen die inhaltliche Ausrichtung des Verlagsmarketings, die den Eindruck hinterlässt, als ob Droemer sein Produkt einfach nicht verstanden hat.
Zunächst produzierte der Verlag eine Art Text-Text-Schere zwischen dem Inhalt des Buches und den Teasern im Katalog und auf der letzten Umschlagseite, die den Eindruck vermitteln, daß in der "Netzhaut" beliebige Mordgeschichten verhandelt werden. Lediglich der Klappentext verrät, daß es um den sexuellen Mißbrauch von Jugendlichen geht. Als der Verlag Damhaugs Krimi für den deutschen Markt vorbereitete, konnte natürlich niemand ahnen, daß in 2010 in Deutschland eine ungeheure Fülle an Informationen über den systematischen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen in Eliteschulen und den Kirchen sowie über die systematische Verschleierung dieser Verbrechen an die Öffentlichkeit gelangen würde. Auch die andauernden Debatten über Täter, Strukturen und Opfer konnte niemand voraussehen. Da sexueller Kindesmißbrauch aber offensichtlich eine anthropologische Konstante ist, hätte das Verlagsmarketing ruhig etwas offensiver ausfallen dürfen.
Torkil Damhaug fragt, wie junge Erwachsene leben, die als Kinder mißbraucht wurden, genauer, welche Bedingungen sie daran hindern, selbst gewalttätig zu werden. Er fragt auch nach der ethischen Haltung der Psychiater und Psychologen, also der Berufsgruppen, die den Opfern helfen sollen, sie aber keinesfalls retraumatisieren dürfen. Diese opferzentrierte Perspektive, die gänzlich ohne Larmoyanz auskommt, steht in der skandinavischen Kriminalliteratur ziemlich einzigartig dar. Und weil der Autor nicht nur über sein Fachgebiet, die Psychiatrie, reflektiert, sondern auch hervorragend erzählt, ist ihm ein intelligenter, hochspannender Plot gelungen, der den Leser bis zur letzten Seite im Unklaren läßt. Übrigens spielt auch die Polizei mit; schließlich sind doch einige Morde aufzuklären. Die Polizei wird – entgegen den Verheißungen auf dem Rücktitel – keinesfalls "an die Grenzen ihrer Belastbarkeit" gebracht, sondern sie ermittelt eher lustlos und letztlich erfolglos. Der ganze Erzählstrang, zu dem auch eine Affaire zwischen jungem Polizisten und gestandener Gerichtsmedizinerin gehört, ist schwächer als die Haupthandlung. Diese Zugeständnisse an die Konventionen des Genres fallen aber kaum ins Gewicht.
Gewichtiger ist da schon die Text-Bild-Schere zwischen Inhalt und Cover. Das Buch wirkt wie blutrünstige angloamerikanische Dutzendware. Der Stadtplan von Oslo im Schutzumschlag ist ein nettes Gimmick, aber völlig überflüssig. Geht es doch um die innere Entwicklung der handelnden Personen und nicht um die geografische Lage ihrer Wohn- und Arbeitsorte. Ebensowenig geglückt ist der deutsche Titel "Die Netzhaut": Netzhäute kommen gar nicht vor. Der poetische norwegische Originaltitel "Døden ved vann" (Der nasse Tod, Death by Water) stammt aus dem Poem "The Waste Land" (Das wüste Land, 1922) von TS Eliot. Er beschreibt eine Situation abgrundtiefer Verzweiflung und verklammert die Thrillerhandlung. Wird da dem deutschen Leser nicht zugetraut, eine nicht einmal besonders subtile Anspielung zu verstehen?
Vielen Dank an Dr. Kerstin Herbst aus Berlin
© Februar 2011 Literaturportal schwedenkrimi.de - Krimikultur Skandinavien
| Buchtipp |
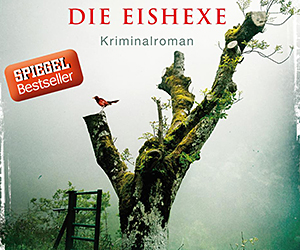 |